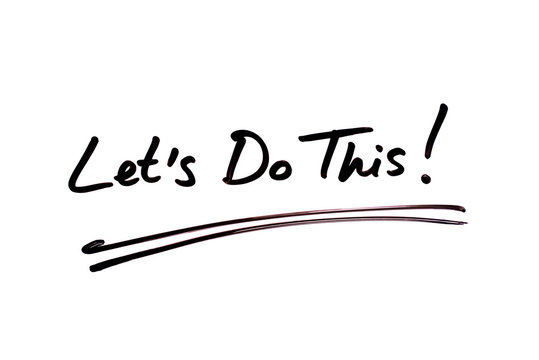Mikrodepots
Beschreibung
Mikro-hubs sind definierte Flächen und Orte, an denen Transportgüter umgeschlagen und zwischengelagert werden. Die Endzustellung wird mit Kleinstfahrzeugen wie Transporträdern, Trolleys oder leichten elektrischen Fahrzeugen vorgenommen. Mit diesen Transporthilfen wird die erste oder letzte Meile zurückgelegt. Dafür braucht es ein hohes Sendungsaufkommen und dicht besiedeltes Zustellgebiet. Mikro depots können sowohl mobil als auch immobile Lösungen sein. Mobile Mikro- hubs können unter anderem Anhängerlösungen oder Wechselbrücken sein. Mobile Mikro Hubs sind meist ebenerdig und brauchen demnach keine Laderampe. Immobile Mikrohubs brauchen mitunter eine Laderampe um das Be- und Entladen von Rollcontainern bzw. das Zu- und Abfahren von Kleinstfahrzeugen wie Transporträder, leichte elektrische Fahrzeuge oder Trolleys zu erleichtern. Eine Laderampe muss etwa mit 3 Meter Tiefe entlang der äußeren Verladewand des Gebäudes berücksichtigt werden. Für Abstellflächen braucht es ca. 10m² pro Kleinstfahrzeug. Diese Fläche kann nachts als Abstellfläche und tagsüber als Pufferfläche für Rollwägen etc. dienen.Als Wege- und Umgschlagflächen sollte pro Kleinstfahrzeug zusätzlich eine Fläche von ca. 5 m² als Umschlagfläche im Innenraum veranschlagt werden. Braucht die Immobilie eine Laderampe, so muss etwa eine Fläche von 3 Meter Tiefe entlang der äußeren Verladewand des Gebäudes berücksichtigt werden. Verkehrsflächen sollten mit mindestens 24-32m² je Versorgungsfahrzeug (3,5-7,5t) kalkuliert werden. Sanitär- und Aufenthaltsräume sollten ca. mit 15m² veranschlagt werden.
Grund/Auswirkung
Mikro-Hubs ermöglichen die Endzustellung mit Kleinstfahrzeugen. Kleinstfahrzeugen eignen sich ideal für die Endzustellung, wenn mit diese mit dem Van nicht gut durchführbar ist und/oder wenn es eine hohe dichte an Empfänger- und Versenderstruktur gibt. Zusätzlich ist eine hohe Belieferungsmenge pro Stopp vorteilhaft. Zum anderen ist die Lage zuVerteilungszentren wichtig sowie die Entfernung des Zustellgebiets zu den Mikro-Hubs. Die Anlieferung sollte möglichst konsolidiert stattfinden um einen positiven Effekt in Bezug auf Umweltauswirkungen bzw. eingesparten KFZ-km und auf die ökomische Effizienz zu haben. Bei konsolidierter Anlieferung kann nämlich auch das Verkehrsaufkommen gesenkt werden. Zusätzlich können gesetzliche Rahmenbedingungen,wie etwa Einfahrtsbeschränkungen, die Nutzung von Mikro-Hubs und die Auslieferung mit Kleinstfahrzeugen attraktiv machen. Unter idealen Umständen können 1,5 Lastenräder ein klassisches Zustellfahrzeug ersetzen. Bei nicht idealer Implementierung kann es durch einen Rebound Effekt zu Doppelfahrten und damit zu einem höheren Verkehrsaufkommen führen.
Planungssicht
Die Planungsmöglichkeit auf Quartiersebene begrenzt sich auf die Standort- und Flächensicherung, die Miteinbeziehung in Stadtentwicklungskonzepte und laufende Planung. Zudem sollten Mikro-Hubs zuerst von einer neutralen und diskriminierungsfreien Instanz betrieben werden wie der Öffentlichen Hand, um KEP- Dienstleister Hemmnisse für die Kooperation zu nehmen.
Nutzung
Die Nutzung des Hubs hängt vom Betreibermodell ab. Zum einen kann zwischen einer White Label Lösung oder einer Lösung eines einzelnen Logistikunternehmens unterschieden werden. Eine White Label Lösung bedeutet, dass ein einziger Betreiber die Anlieferungen für andere Logistik-Betriebe übernimmt . Somit kann zwischen Single User und Multi User Hubs unterschieden werden. Bezogen auf die zeitliche Nutzung kann zwischen dauerhafter und temporärer Nutzung unterschieden werden. Die temporäre Nutzung für logistische Zwecke z.B. für wenige Stunden kann die Nutzung der Fläche bzw. Räume für andere Aktivitäten außerhalb der betrieblichen Nutzungszeiten ermöglichen. Ein Multi-User Mikro Depot braucht einen Betreiber, der eine Schnittstelle zwischen den Immobilieneigentümer und den KEP-Dienstleistern ist. Der Betreiber wird seinerseits von KEP-Dienstleistern für die Aufwendungen (Investitionskosten und laufende Kosten) entgolten. Das Betreiberunternehmen kann entweder ein privater Akteur, ein öffentlich-rechtlicher Akteur oder privat und öffentlich-rechtliche Akteure sein. Ein privater Akteur als Betreiber kann kartellrechtliche Probleme mit sich ziehen, wenn der Zugang zu dieser Rolle nicht diskriminierungsfrei gestaltet ist. Zum anderen gibt es im KEP-Bereich einen sehr starken Wettbewerb, weshalb andere KEP-Betreiber zögerlich sein können eine gemeinsame Nutzung vor allem unter der Leitung eines privaten Akteurs, der eventuell selbst ein KEP- Unternehmen ist, zuzustimmen.
Quellen
Handbuch